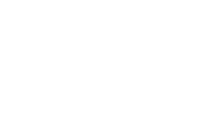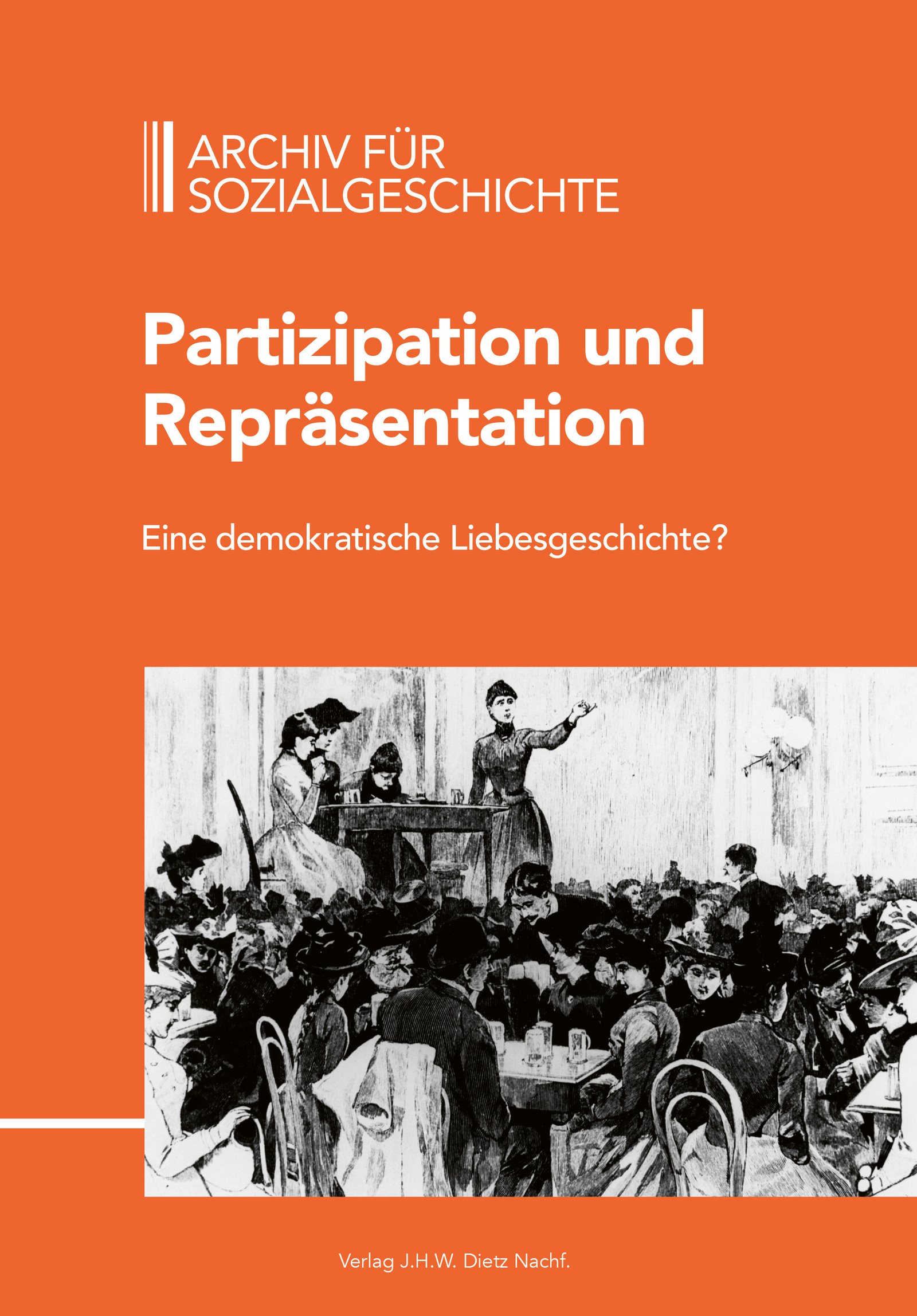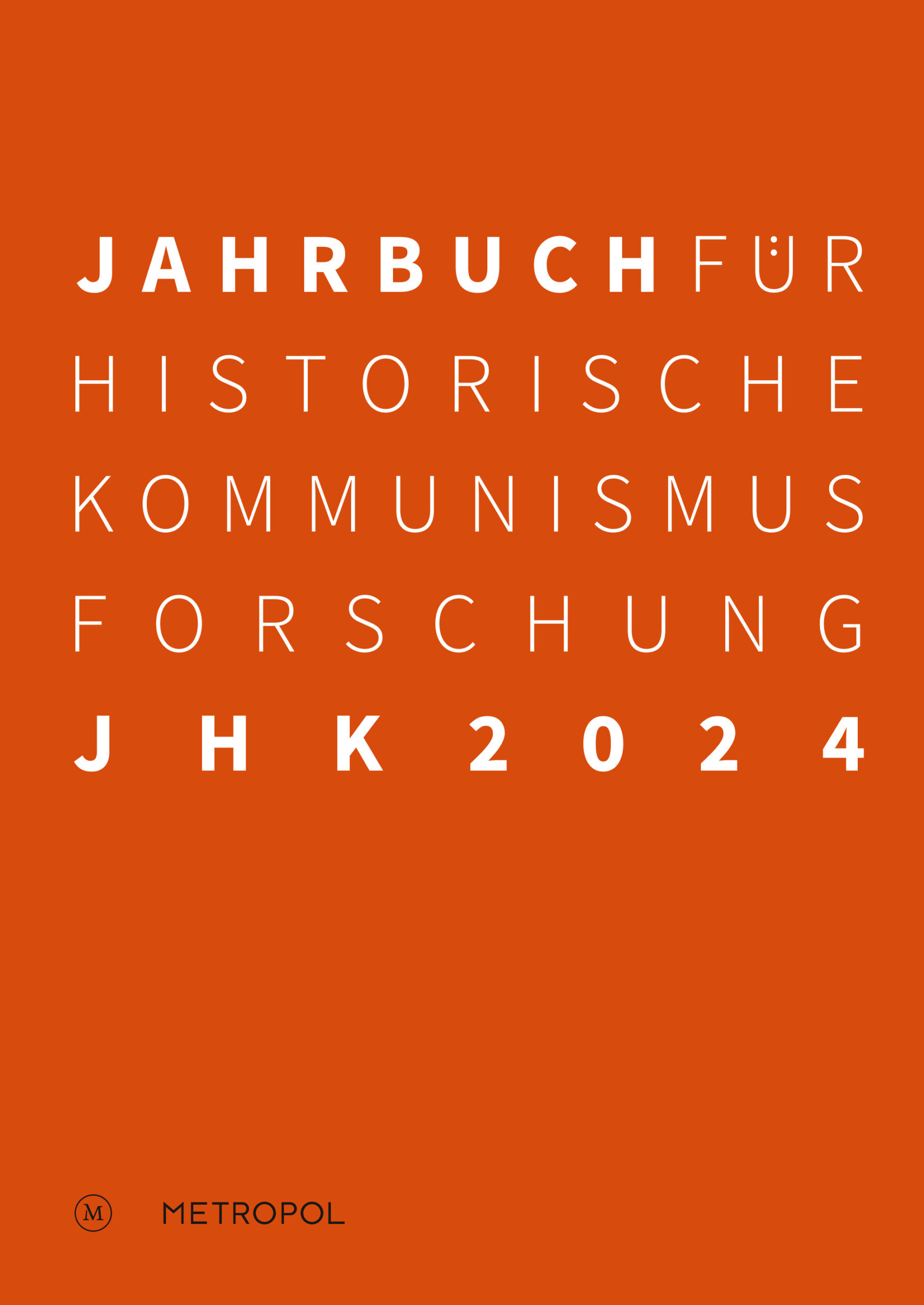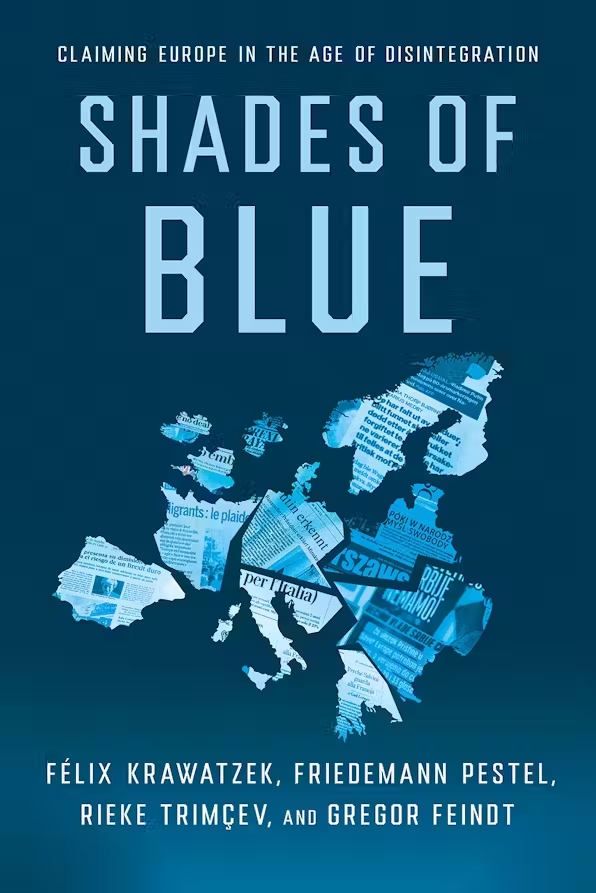Dr. Claudia Christiane Gatzka

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Professur für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas
Historisches Seminar
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Besucheradresse:
KG IV, Rempartstr. 15, Raum 4419
Tel. +49 / (0)761 / 203 3451
Email: claudia.gatzka (at) geschichte.uni-freiburg.de
Forschungsprojekt: http://verborgene-stimmen.de
Kommende Sprechstunden:
Mo, 26. Januar 2026, 18.00–19.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Vita
| seit 1/2020 | Akademische Rätin a. Z. an der Professur für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| seit 12/2020 | Leitung des Projekts "Verborgene Stimmen der Demokratie. Politische Repräsentationen des Volkes in der Bundesrepublik, 1945–2000", gefördert von der Gerda Henkel Stiftung |
| seit 2022 | Mitherausgeberin des Archivs für Sozialgeschichte |
| 7/2021–10/2022 | Mutterschutz & Elternzeit |
| seit 2020 | Fellow am Progressiven Zentrum, Programmbereich Resiliente Demokratie |
| 2015– 2019 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (in Vertretung) an der Professur für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| 2016 | Promotion, Humboldt-Universität zu Berlin (summa cum laude) |
| 2011–2015 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts |
| 2011 | Magistra Artium, Humboldt-Universität zu Berlin (mit Auszeichnung) |
| 2004– 2011 | Studium der Neueren/Neuesten Geschichte, Mittelalterlichen Geschichte, Politikwissenschaft und Europäischen Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien Universität Berlin und der Università degli Studi di Bologna |
Stipendien, Auszeichnungen, Drittmittel
| 10/2023–9/2024 | Postdoc-Fellowship der Gerda Henkel Stiftung |
| 11/2021–10/2022 | Postdoc-Fellowship der Gerda Henkel Stiftung |
| 2019 |
Bewilligung des Forschungsprojekts "Verborgene Stimmen der Demokratie. Politische Repräsentationen des 'Volkes‘ in der Bundesrepublik, 1945-2000" durch die Gerda Henkel Stiftung | Projektlaufzeit 12/2020-3/2026
|
| 2017 | Tiburtius-Preis der Berliner Hochschulen (1. Preis) für die Dissertation |
| 2013 + 2015 | Doktorandenstipendium des Deutschen Historischen Instituts Rom |
| 2011 | Abschlussstipendium der Philosophischen Fakultät I der Humboldt-Universität zu Berlin |
| 2010 | DAAD-Stipendium für die Magisterarbeit, Bologna |
| 2009/10 | Erasmusstipendium, Bologna |
Forschungsinteressen
- Demokratiegeschichte seit dem 19. Jahrhundert
- Empire und Massenkultur im 19. und 20. Jahrhundert
- Geschichte des Tourismus, des Reisens und der nationalen und sozialen Stereotype im 19. und frühen 20. Jahrhundert
- Politische Kommunikation, Repräsentation, Partizipation vom 19. bis zum 21. Jahrhundert unter Berücksichtigung geschlechtergeschichtlicher Aspekte
- Stadtgeschichte, Alltagsgeschichte, praxeologische Ansätze, Geschichte popularer Kulturen
- Geschichte, Theorie und Methoden der Geschichtswissenschaft, Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Public History
- Vergleichende und transnationale europäische Geschichte mit Schwerpunkt Italien und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert sowie mit Blick auf die Verflechtungen mit dem Nahen Osten
Forschungsprojekte
Touristen und die Anverwandlung von Welt im imperialen Zeitalter, 1840-1940
laufendes Habilitationsvorhaben
Seit den 1830er Jahren begann die Figur des Touristen europäische und globale Räume außerhalb der eigenen Heimat zu erkunden. Ihre Präsenz war so markant, dass ihr alsbald nicht nur die Erkundung, sondern auch die Eroberung fremder Räume zugetraut wurde, freilich mit nicht-militärischen Mitteln. In der Tat gingen touristische Strukturen und koloniale Verhältnisse nicht nur miteinander einher; auch gingen touristische Strukturen einer faktischen Kolonisierung bisweilen voraus. Das Projekt widmet sich vor diesem Hintergrund den Auslandstouristen als Repräsentanten ihrer Nation und als Agenten des eigenen (entstehenden) Empires. Darüber hinaus waren sie Träger weiterer sozialer Sinnbezüge, die auf die normativen Ordnungen der aussendenden Gesellschaften zurückverwiesen und diese im Ausland zur Disposition stellten. Kernfrage der Studie ist, welche Rolle die Auslandstouristen bei der (Re-)Präsentation und Stabilisierung ihrer nationalen und sozialen Herkunftsräume spielten und welche Bedeutung dabei den transnationalen Kontakten und gegenseitigen Wahrnehmungen an wichtigen Destinationen innerhalb wie außerhalb Europas zukam. Das Projekt rekonstruiert so die umkämpfte informelle Inbesitznahme fremder Territorien durch reisende Nationen und soziale Klassen. Es vermisst die Reiseimperien, die sich durch Verflechtungen mit den besuchten Räumen formten, und erforscht die Regeln und Wirkungen transnationaler Begegnungen und Beobachtungen an Destinationen, die nicht zum eigenen Staatsgebiet gehörten. Mit besonderem Fokus auf deutsche Touristen in Interaktion mit Anderen in der Schweiz und Italien, in Ägypten und Palästina sowie in den europäischen Metropolen und überseeischen Kolonien zielt das Buchprojekt auf eine transnationale Geschichte der informellen Expansion, ihrer zeitgenössischen Reflexion und ihrer Grenzen von den Anfängen des modernen Tourismus bis zum Kulminationspunkt imperialen Ausgreifens um 1940.
Verborgene Stimmen der Demokratie. Politische Repräsentationen des ,Volkes‘ in der Bundesrepublik, 1945-2000
Forschungsprojekt gefördert durch die Gerda Henkel Stiftung, Laufzeit 2020-2024, Projektmitarbeit: Tabea Nasaroff und Dr. Janosch Steuwer
In diesem Rahmen bearbeite ich die Buchprojekte:
1. Demokratie und Diktatur. Geschichte und Gegenwart einer Grenzziehung
Das Buch zeichnet nach, was Zeitgenossinnen und Zeitgenossen in Deutschland seit dem Kaiserreich mit "Demokratie" und "Diktatur" verbanden. Anhand politischer Kommunikation in Parlament und auf Kundgebungen, in Presse und Rundfunk sowie in Briefen und Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern arbeite ich heraus, welche Erwartungen und Erfahrungen, aber auch welche politischen Sprechakte mit "Demokratie" und "Diktatur" verbunden waren, und welche Vielfalt, aber auch welche verschwommenen Grenzen diese beiden mutmaßlich binären Alternativen politischer Ordnung kennzeichneten und bis heute kennzeichnen – nicht zuletzt in der aktuellen Historiographie. Ein gewissenhaftes Sezieren der Semantiken, Praktiken und Deutungen von Demokratie und Diktatur, die das Buch auf den Feldern der Repräsentation und Partizipation, der Demonstrationen und Manifestationen auf der Straße sowie des privaten sozialen Miteinanders vornimmt, soll schließlich helfen, die beiden Begriffe und ihre historischen Dimensionen klarer voneinander abzugrenzen. So präsentiert das Buch keine politische Theorie, sondern eine historische Praxiskunde von Demokratie und Diktatur, die zur Hand genommen werden kann, um in aktuellen Debatten den Überblick zu behalten.
2. Im Namen des Volkes. Demokratie und Repräsentationen in der Bundesrepublik seit 1949
Das Projekt thematisiert ein zentrales Alltagsproblem der Massendemokratie seit dem 20. Jahrhundert: die Frage, wie Repräsentierte und politische Repräsentanten ihre Beziehungen zueinander gestalten. Es erforscht die Lust vieler Bürgerinnen und Bürger, jenseits der Wahlen mitzureden, mitzubestimmen und den Gewählten Feedback zu geben, die sich vor dem Internetzeitalter in Briefen und anderen Artikulationsformen äußerte. Wann zeigten sich Wählerinnen und Wähler gut vertreten und wie inszenierten sie sich als Demos? Und wie versuchten die Gewählten, „das Volk“ abzubilden, mit ihm in Kontakt zu treten und in seinem Namen zu sprechen? Diesen Fragen geht das Projekt seit den Anfängen der Bundesrepublik nach und erkundet so die bislang im Dunkeln liegenden Mechanismen politischer Legitimationsstiftung in der repräsentativen Demokratie, ihre deutschen Besonderheiten und ihren Wandel durch die Zeit.
Publikationen
Monographien
- Demokratie und Diktatur. Geschichte und Gegenwart einer Grenzziehung, Hamburg: Hamburger Edition, erscheint 2026, ca. 450 S.
- Die Demokratie der Wähler. Stadtgesellschaft und politische Kommunikation in Italien und der Bundesrepublik 1944-1979
(Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 179 / Parlament und Öffentlichkeit 9), Düsseldorf: Droste 2019, 616 S. full pdf
Rezensionen: FAZ (Christiane Liermann) | HSozKult (Thomas Schlemmer) | HZ (Thomas Stockinger) | Jahrbuch Extremismus und Demokratie 2020 (Wilfried von Bredow) | Archiv für Sozialgeschichte 60, 2020 (Zoé Kergomard) | American Historical Review (Patrick Bernhard)
Herausgegeberschaften
- Politische Partizipation = Themenheft Geschichte und Gesellschaft (mit Paul Nolte), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, in Vorbereitung.
- Neue Wege zu einer Geschichte der Bundesrepublik (hg. mit Sonja Levsen), Berlin: Suhrkamp 2025.
- Partizipation und Repräsentation – eine demokratische Liebesgeschichte? = Archiv für Sozialgeschichte 65 (2025) (hg. mit Kirsten Heinsohn, Thomas Kroll, Anja Kruke, Philipp Kufferath, Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Nikolai Wehrs und Meik Woyke), Bonn: Dietz 2025.
- Der Ort des Kommunismus in den westeuropäischen Demokratien seit 1945 (hg. mit Dominik Rigoll und Ulrich Mähler) = Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2025, Berlin: Metropol 2025.
Rezension: H-Soz-Kult (Milan Mentz), FAZ (Eckhard Jesse), 6.8.2025
- Schleichend an die Macht. Wie die Neue Rechte Geschichte instrumentalisiert, um Deutungshoheit über unsere Zukunft zu erlangen (mit Andreas Audretsch), Bonn: Dietz 2020, 2. Aufl. Bonn 2020.
Podcast zum Buch und SPIEGEL-Interview zum Buch
Rezensionen: zeitgeschichte (Klaus-Dieter Mulley) | taz (Sabine Am Orde) | Vorwärts (Renate Faerber-Husemann) | gegneranalyse.de (Anja Maier) | jungle world (Felix Schilk) | demokratischer salon (Norbert Reichel)
- Wahlen in der transatlantischen Moderne (mit Hedwig Richter und Benjamin Schröder) = Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 23/1, Leipzig 2013.
Mitherausgeberschaften
- (in Vorbereitung) Sozial- und Kulturgeschichte der Gegenwart. Gesellschaftlicher Wandel seit 1990 = Archiv für Sozialgeschichte 66 (2026), Bonn: Dietz, erscheint 2026.
- Migration in der Moderne: Wege - Orte - Erfahrungen = Archiv für Sozialgeschichte 64 (2024), Bonn: Dietz 2024.
- Rechtsextremismus nach 1945 = Archiv für Sozialgeschichte 63 (2023), Bonn: Dietz 2023.
Aufsätze und Essays
in Vorbereitung / im peer review
- Politische Repräsentation als Gegenstand der Zeitgeschichte, in: Zeithistorische Forschungen, in Vorbereitung.
- (Nicht-)Beteiligung im Kampf der Ideologien. Politiken der Partizipation in Deutschland und Italien zwischen Demokratie und Diktatur, in: Geschichte und Gesellschaft, in Vorbereitung.
- Democratism versus anti-democratism: Too simple a plot for the German Empire?, in: Jennifer Allen/ Tilman Venzl/ Kirk Wetters (Hg.),Writing Democracy: Literature, History, and the Promises of a Concept, in Vorbereitung.
im Erscheinen
- Staatsbürger versus Parteien. Historische Soziologie eines vergessenen Demokratiekonflikts der jungen Bundesrepublik, in: Berliner Journal für Soziologie, im Erscheinen.
- Feinde im Fremdenverkehr? Transnationale Begegnungen im europäischen Tourismus ca. 1880–1930, in: Jan-Hinnerk Antons/David Feest (Hg.), Zu Gast bei Feinden? Aussöhnung und Tourismus in Europa (= Publikationen des Nordost-Instituts), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, erscheint 2026.
- Verschwimmende Grenzen zwischen Demokratie und Diktatur: ein aktueller Trend und seine Folgen, in: Publikationen der Gedenkstätte Ahlem, im Erscheinen.
- Perspektiven auf politische Partizipation in der Bundesrepublik. Kommentar, in: Paul Nolte/Martina Steber (Hg.), Zerbrechliche Stabilität. Zeithistorische Blicke auf die bundesrepublikanische Demokratie, erscheint Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2026.
- Ein Politikum ersten Ranges. Die Richtungsentscheidung für die Verhältniswahl und der Versuch ihrer Revision 1919/49–1970, in: Christian Walter/ Andreas Wirsching (Hg.), Kontroverse Richtungsentscheidungen, erscheint Tübingen: Mohr Siebeck, erscheint 2026.
erschienen
- Berlin is not Bonn is not Weimar. Vying political interpretations of the German republics, in: Germany's History Wars. Contesting Memory and Identity Today, ed. by Jürgen Zimmerer, Berlin/Boston 2026, 359–374.
- Sehepunkte im Wandel. Die Bundesrepublik und ihre Geschichten (mit Sonja Levsen), in: Claudia C. Gatzka/ Sonja Levsen (Hg.), Neue Wege zu einer Geschichte der Bundesrepublik, Berlin: Suhrkamp 2025, 7–38.
- Demokratie, in: Claudia C. Gatzka/ Sonja Levsen (Hg.), Neue Wege zu einer Geschichte der Bundesrepublik, Berlin: Suhrkamp 2025, 502–529.
- Kein Volk, nirgens, in: Zeitschrift für Ideengeschichte, Themenheft: Weltmacht DDR, Heft XIX/4, 109–113.
- Wozu Revolution? Der Demokratiekonflikt von 1918, in: Prospect 25. Bulletin der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte (GEDG), 10–14.
- Compagne presenti ma invisibili. Dimensioni femminili nella base del PCI in Puglia, in: Fiammetta Balestracci (Hg.), Donne comuniste nell'Italia del Novecento. Partito, società, identità di genere, Rom: Viella 2025, 321–337. [Präsent, aber unsichtbar. Dimensionen des weiblichen Aktivismus an der Basis der Kommunistischen Partei Italiens in Apulien]
- Repräsentation und Partizipation – ein Spannungsfeld der Demokratiegeschichte. Einleitung (mit Anja Kruke), in: Archiv für Sozialgeschichte 65 (2025), 9–28.
- Der Ort des Kommunismus in den westeuropäischen Demokratien. Beginn einer Spurensuche (mit Dominik Rigoll), in: Jahrbuch für Historische Kommunismusmusforschung 2025, 1–18.
- Politische Repräsentation zwischen Wahlkreis und Bundeshaus. Abgeordnete der SPD und CDU/CSU als Volksvertreter, 1949-1980, in: Peter Beule (Hg.), Im Zentrum der Demokratie. Zur Geschichte und politischen Arbeit der SPD-Bundestagsfraktion, Düsseldorf: Droste 2024, 231–280.
- Politische Kommunikation zwischen Wählern und Gewählten: Zeithistorische Befunde, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 38-39/2024, 33–39.
- Feedback von der Peripherie der Demokratie. Bürgerbriefe und politische Repräsentation in der Bundesrepublik, 1949–1980, in: Ernst Wolfgang Becker/ Frank Bösch (Hg.), Partizipation per Post. Bürgerbriefe an Politiker in Diktatur und Demokratie (= Zeithistorische Impulse 16), Stuttgart: Franz Steiner 2024, 187–215.
- Demokratie als Diktatur denken, und umgekehrt, in: Merkur, Heft 900, Mai 2024, 89–98.
- Preparing the stages for popular deliberation. Political parties, voters and extra-parliamentary communication in West Germany and Europe, 1940s–70s, in: Parliaments, Estates, and Representation 44 (2024) 1, 80–97.
- Definire lo standard. Svizzera e Alta Italia come mete del turismo britannico, dagli anni Trenta ai Settanta dell’Ottocento, in: Geschichte und Region / Storia e Regione 32 (2023) 1, 91–119. [Den Standard setzen. Die Schweiz und Oberitalien als britische Tourismusdestinationen, 1830er bis 1870er Jahre]
- Geschichten wider den Osten, in: Merkur, Heft 893, Oktober 2023, 5–18.
- Berlin ist nicht Bonn ist nicht Weimar. Die deutschen Republiken im politischen Deutungskampf, in: Jürgen Zimmerer (Hg.), Erinnerungskämpfe. Neues deutsches Geschichtsbewusstsein, Reclam: Ditzingen 2023, 414–432.
- Die Pyramide als Zeitmaschine. Chronoferenzen im Ägypten-Tourismus des 19. Jahrhunderts, in: Mirjam Hähnle/Julian Zimmermann (Hg.), Objektzeiten. Die Relationierung historischer Zeiten durch Relikte (6.–20. Jahrhundert) (Paradigmeita 75), Freiburg/Baden-Baden: Rombach 2023, 259–289.
- Nationalismus in der Zeitgeschichte, in: Merkur, Heft 886, März 2023, 5–20.
- 1848/49 und der Ort des Revolutionären in der deutschen Geschichte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 7–9/2023, 4–9.
- Weimar in der „demokratischen“ Tradition des Kaiserreichs?, in: Alexander Gallus/Ernst Piper (Hg.), Die Weimarer Republik als Ort der Demokratiegeschichte (= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 10897), Bonn 2023, 40–60.
- Demokratiegeschichte und Zeitgeschichtsforschung. Eine Bestandsaufnahme mit Claudia Gatzka, Sonja Levsen, Benedikt Wintgens und Janosch Steuwer (Gespräch mit Alina Müller), in: Zeitgeschichte online, Dezember 2022, URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/demokratiegeschichte-und-zeitgeschichtsforschung.
- Political education and electoral politics: Communists and Catholics as teachers of democracy in early postwar Italy, in: European Review of History 29 (2022) 6, 884–906.
- Demos deluxe? "Das Volk" der Bundesrepublik vor und nach 1989/90, in: Marcus Böick/ Constantin Goschler/ Ralph Jessen (Hg.), Jahrbuch Deutsche Einheit 2022, Berlin: Ch. Links Verlag 2022, 53–76.
- Post vom Volk. Geschichtskolumne, in: Merkur, Heft 880, September 2022, 55–64.
- Die Rezension als Schaufenster historischen Denkens, in: H-Soz-Kult, 06.05.2022, <www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-5378>.
- Die deutsche Demokratiegeschichte und der Blick ins Ausland, in: Lars Lüdicke (Hg.), Deutsche Demokratiegeschichte. Eine Aufgabe der Vermittlungsarbeit, Berlin: bebra Verlag 2021, 31–44.
- "Das Kaiserreich" zwischen Geschichtswissenschaft und Public History, in: Merkur, Heft 866, Juli 2021, 5–15.
- Konfliktlinien deutscher Demokratiegeschichtsschreibung / Lines of Conflict in German Historiography of Democracy (mit Sonja Dolinsek) in: Public History Weekly 9 (2021) 3, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18178.
- Baedeker and the invention of landscape identity / Baedeker und die Erfindung der Landschaftsidentität, in: Public History Weekly 9 (2021) 3, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-17823.
- Das Parlament als umstrittener Ort der deutschen Demokratiegeschichte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 38/2020, 4–10.
- wieder abgedruckt in: Repräsentation, Identität, Beteiligung. Zum Zustand und Wandel der Demokratie, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2022, 218–229.
- La democrazia degli elettori in Italia e nella Repubblica Federale Tedesca (1944-1979), in: Maurizio Cau/ Christoph Cornelißen (Hg.), I media nei processi elettorali. Modelli ed esperienze tra età moderna e contemporanea, Bologna: Il Mulino 2020, 285–305. [Die Demokratie der Wähler in Italien und der Bundesrepublik Deutschland (1944–1979)]
- Praktiken der 'Demokratie'. Über ein Problem politischer Kommunikation nach 1945, in: HEUSS-FORUM 1/2019, URL: www.stiftung-heuss-haus.de/heuss-forum_1_2019, 06.03.2020.
- Marchin' Maiden. Zur politischen Ikonographie des weiblichen Aktivismus in der Demokratie, in: Moral Iconographies. Bild und Moral in der Moderne, URL: https://moralicons.hypotheses.org/1002, 30.10.2019.
- National Socialism: What We Can Learn Today / Nationalsozialismus: Was wir heute lernen können, in: Public History Weekly 7 (2019) 14, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2019-13731, 18.04.2019.
- Die Blüte der Parteiendemokratie. Politisierung als Alltagspraxis in der Bundesrepublik, 1969-1980, in: Archiv für Sozialgeschichte 58 (2018), 201–223. pdf
- Das "Volk" auf postfaschistischen Straßen. Zum Fortleben eines Kulturmusters in Italien und der Bundesrepublik, 1945-1960, in: Marie-Luise Recker/ Andreas Schulz (Hg.), Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa, Düsseldorf: Droste 2018, 167–184. pdf
- Democrazie porta a porta. Comunicazione politica nelle città italiane e tedesche del secondo dopoguerra, in: Stefano Cavazza/ Filippo Triola (Hg.), Parole sovrane. Comunicazione politica e storia contemporanea in Italia e Germania, Bologna: Il Mulino 2017, 183–205. [Demokratien Tür and Tür. Politische Kommunikation in den italienischen und westdeutschen Städten in der Nachkriegszeit] pdf
- Die Nachkriegsstadt als Ort politischer Kommunikation. Überlegungen am Beispiel Westdeutschlands und Italiens 1945-1968, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2/2016, 91–108. pdf
- „Demokratisierung“ in Italien und der Bundesrepublik. Historiographische Narrative und lokale Erkundungen, in: Sonja Levsen/ Cornelius Torp (Hg.), Wo liegt die Bundesrepublik? Vergleichende Perspektiven auf die westdeutsche Geschichte, 1945-1989, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016, 145–165. pdf
- Anders unter Gleichen. Frauen, Männer und Weiblichkeit im italienischen Kommunismus der Nachkriegszeit, in: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2015, 95–112. pdf
- Des Wahlvolks großer Auftritt. Wahlritual und demokratische Kultur in Italien und Westdeutschland nach 1945, in: Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 23 (2013) 1, 64–88. pdf
- Zur Kulturgeschichte moderner Wahlen in vergleichender Perspektive. Eine Einleitung, in: Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 23 (2013) 1, 7–19 (mit Hedwig Richter und Benjamin Schröder). pdf
- Kommunisten besetzen eine Stadt im kapitalistischen Westen. Umkämpfte Räume und Raumkontrolle im roten Bologna (1950er bis 1970er Jahre), in: Eliza Bertuzzo/ Eszter B. Gantner/ Jörg Niewöhner/ Heike Oevermann (Hg.), Kontrolle öffentlicher Räume. Unterstützen, Unterdrücken, Unterhalten, Unterwandern (Zeithorizonte. Perspektiven Europäischer Ethnologie 12), Berlin u.a.: LIT Verlag 2013, 180–198. pdf
- Klassenkampf am Küchentisch. Weibliche Handlungsräume im kommunistischen Milieu Italiens der frühen Nachkriegszeit, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte 61 (2012), 48–53. pdf
- Der „neue Mensch“ auf ausgetrampelten Pfaden. Kommunistische Bewährung und politischer Massenmarkt im postfaschistischen Italien, in: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2012, 145–157. pdf
Medien und Wissenschaftstransfer (Auswahl)
- Video: Demokratie und Diktatur. Zu Gast bei L.I.S.A. Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, 20.10.2025.
- Text: "Whatever it takes". Demokratische Legitimationsfragen, in: APuZ, 21.03.2025.
- Radio: Der Souverän hat das Wort: Die Deutschen und die Qual der Wahl, in: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs, 23.2.2025.
- Podcast: MDR Wahlkreis Ost, Thema: "Woran unsere Demokratie krankt", mit Anja Maier und Malte Pieper, 7.2.2025.
- Text: Vom Osten was Neues, in: FOCUS Magazin, 20.12.2024.
- Radio: Wenn Bürger sich nicht repräsentiert fühlen. Gespräch mit Thorsten Jantschek, in: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs, 1.12.2024.
- TV / im Gespräch mit der Politik: Gast in Fakt ist! (MDR) am 4.11.2024.
- Podcast: Demokratie anders erzählen, in: Politikum (WDR 5), 28.10.2024.
- Interview zum Sprechen über "den Osten" mit Sebastian Fischer und Eva-Maria Schnurr in: SPIEGEL Online, 5.10.2024.
- Text: Erster Bundestagswahlkampf: "Schlagt sie tot", in: Die ZEIT, 1.8.2024.
- Text: Verzerrter Volkswille, in: taz, 24.6.2024.
- Podcast: "Hintergrundgespräch" des Landtags Rheinland-Pfalz mit Landtagspräsident Hendrik Hering zum Thema „Parlamente & Demokratiegeschichte(n)“, 14.4.2023, https://www.youtube.com/watch?v=RSKdUkO6-_M.
- Radio: Politische Teilhabe im Netz: "Der Fokus auf Hatespeech ist eine verzerrte Wahrnehmung". Gespräch mit Michael Köhler im Deutschlandfunk, 23.10.2022.
- Radio: "Wir sind das Volk – Wir sind ein Volk": Wandel eines schwierigen Begriffs. Gespräch in SWR2, 21.9.2022.
- Video: Gespräch mit Maria Neumann zum historischen Kontext der ersten documenta-Ausstellung 1955 unter dem Titel "Kunst und Gesellschaft in Italien und Deutschland: Antifaschismus oder Postfaschismus?" in der Reihe "Vergiftete Verhältnisse - Gespräche zur Gegenwartskunst", documenta Institut Kassel, 4.7.2022.
- Text: Noch niemals in New York. Wieviel Autopsie gehört zur Empirie?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.1.2022.
- politische Bildung: Geschichtspolitik und liberale Demokratie. Mit Geschichte wird Politik gemacht, Online-Seminar plus Lehrmaterialien für die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Juni 2021.
- im Gespräch mit der Politik: Deine Stimme in Berlin? Gespräch mit Anna Lührmann (B90/Grüne) über Wahlkampf im Wahlkreis, Heinrich Böll Stiftung, 31.5.2021.
- Text: Warum Wählen nicht alles ist, in: wir machen das. magazin, 5.11.2020.
- Text: Populistische Pappkameraden, in: Der Hauptstadtbrief, 10.10.2020.
- Radio: Was Sie nicht über deutsche Geschichte wussten, aber unbedingt wissen sollten: das Drehbuch der Großstadt. Gespräch in RBB Kultur, 29.07.2020.
- Text: "Worthülsen von Nation, Volk und Rasse". Interview mit Christoph Gunkel, in: SPIEGEL Online, 16.07.2020.
- Text: "Die neurechten Thesen streuen sehr weit". Interview mit Christian Bangel, in: ZEIT Online, 16.05.2020 (mit Andreas Audretsch).
- Text: Wissenschaft als Profession, in: Erziehung und Wissenschaft 4/2020, S. 2.
- politische Bildung: Demokratieverständnisse. Was ist Demokratie und was kann sie sein? Eröffnungsvortrag und Podiumsdiskussion auf der Fachtagung der Bundeszentrale für politische Bildung "Prävention wofür? Demokratieverständnisse in politischer Bildung und sozialer Arbeit", 24./25.9.2019.
- Text: Die Fristen der Forschung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.05.2019.
Rezensionen
- David Stasavage, The Decline and Rise of Democracy. A Global History from Antiquity to Today, Princeton/Oxford: Princeton University Press 2020, in: Connections. A Journal for Historians and Area Specialists, 20.10.2023.
- Ute Daniel, Postheroische Demokratiegeschichte. Hamburg: Hamburger Edition 2020, in: Historische Zeitschrift 314 (2022), H. 2, 505–506.
- Featured Review: Pamela Ballinger, The World Refugees Made: Decolonization and the Foundation of Postwar Italy. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 2020, in: The American Historical Review 126 (2021) 3, 1221-1224.
- Michael Epkenhans/ Ewald Frie (Hg.), Politiker ohne Amt. Von Metternich bis Helmut Schmidt, Paderborn: Schöningh 2020, in: H-Soz-Kult, 12.03.2021.
- Benedikt Wintgens, Treibhaus Bonn. Die politische Kulturgeschichte eines Romans, Düsseldorf: Droste 2019, in: sehepunkte 21 (2021), Nr. 1 [15.01.2021].
- Verena Kümmel, Vergangenheit begraben? Die gestohlenen Leichen Mussolinis und Pétains und der Kampf um die Erinnerung, Köln u. a.: Böhlau 2018, in: Neue Politische Literatur 66 (2021) 1, 124–126, DOI: https://doi.org/10.1007/s42520-020-00341-z (05.01.2021).
- Bernhard Gotto, Enttäuschung in der Demokratie. Erfahrung und Deutung von politischem Engagement in der Bundesrepublik Deutschland während der 1970er und 1980er Jahre, Berlin: De Gruyter 2018, in: Archiv für Sozialgeschichte (online) 60 (2020).
- Janosch Steuwer, "Ein Drittes Reich, wie ich es auffasse". Politik, Gesellschaft und privates Leben in Tagebüchern 1933-1939, Göttingen: Wallstein 2017, in: Historische Anthropologie 28 (2020) 1, 143–144.
- Stefano Cavazza/ Thomas Großbölting/ Christian Jansen (Hg.), Massenparteien im 20. Jahrhundert. Christ- und Sozialdemokraten, Kommunisten und Faschisten in Deutschland und Italien, Stuttgart: Franz Steiner 2018, in: H-Soz-Kult, 08.02.2019.
- Martin Baumeister/ Bruno Bonomo/ Dieter Schott (Hg.), Cities Contested. Urban Politics, Heritage, and Social Movements in Italy and West Germany in the 1970s, Frankfurt/New York: Campus 2017, in: H-Soz-u-Kult, 29.09.2017.
- Michaela Fenske, Demokratie erschreiben. Bürgerbriefe und Petitionen als Medien politischer Kultur 1950-1974, Frankfurt/New York: Campus 2013, in: Archiv für Sozialgeschichte (online) 56, 2016.
- Erol Yildiz: Die weltoffene Stadt. Wie Migration Globalisierung zum urbanen Alltag macht, Bielefeld: transcript 2013, in: sehepunkte 13 (2013), Nr. 12 [15.12.2013].
- Paul Corner: The Fascist Party and Popular Opinion in Mussolini's Italy. Oxford 2012, in: H-Soz-Kult, 01.11.2013.
Tagungsberichte
- Historikertag 2016: Westeuropa, in: H-Soz-Kult, 19.05.2017.
- Kultur und Praxis der Wahlen. Eine Geschichte der modernen Demokratie / Culture and practice of elections. A history of modern democracy. 15.05.2014-16.05.2014, Greifswald, in: H-Soz-Kult, 28.07.2014.